Im Herbst letzten Jahres besuchte ich Tohoku, den „Nordosten“ von Honshu, der größten Insel Japans. Ein befreundetes japanisches Ehepaar hatte mir angeboten, sie dort auf den Spuren der Samurai zu begleiten.
Von Tokyo ging es mit dem Shinkansen Richtung Norden, und zwar schnell, bequem und pünktlich auf die Minute.

Um an die meist abgelegenen historischen Stätten zu gelangen, mussten wir gelegentlich in wesentlich langsamere Regionalzüge umsteigen, was sich als überaus unterhaltsam erwies, da wir mal auf Plüschsesseln, mal auf Tatami-ähnlichen Matten saßen und manchmal sogar ein Kulturprogramm genießen konnten.

Dichte Wälder, hohe Berge, stille Täler und heiße Quellen prägen den Nordosten Honshus – ein Paradies für Wanderer und Freunde traditioneller japanischer Thermalbäder. Ein Landstrich voller Mythen und Legenden, die von den Helden des alten Japan erzählen, von den Samurai.

Wer waren die Samurai?
Vielen Japanern gelten die Samurai bis heute als nationales Symbol für Ehre, Aufrichtigkeit und Treue.
Ursprünglich nannte man sie Bushi, Krieger. Sie standen als Leibwächter und Soldaten im Dienst der Adligen. Ab dem 12. Jahrhundert entwickelten sie sich zu einer mächtigen Kriegerelite, deren prägender Einfluss auf die japanische Gesellschaft über Jahrhunderte anhielt und bis heute spürbar ist.
Im Laufe der Zeit setzte sich der Begriff Samurai durch, abgeleitet von dem Verb saburau, schützen/dienen, was darauf hindeutet, dass die Krieger zunehmend auch in zivilen Bereichen tätig wurden.
Die Samurai galten als „Herren des Schwertes“. Oft heißt es, das Schwert sei die Seele des Samurai.
Samurai dienten einem Herrn. Dies konnte ein Shogun (Militärgouverneur) sein, ein Daimyo (Feudalfürst), ein Adliger oder ein hochrangiger Samurai, der eigene Krieger um sich sammelte. Sie lebten und kämpften für ihren Herrn, waren ihm loyal ergeben und folgten ihm notfalls bis in den Tod. Zu den Tugenden der Samurai gehörten Gerechtigkeitssinn, Aufrichtigkeit, Mut und Höflichkeit. Die eigene Ehre galt ihnen als höchstes Gut.
Jahrelang trainierten sie den Kampf mit Schwert, Pfeil und Bogen. Ihre Rüstung und ihre Waffen bestanden aus hochwertigen Materialien und wurden von den besten Kunsthandwerkern des Landes gefertigt. Sie waren so wertvoll, dass sie Kunstwerken gleich an nachfolgende Generationen vererbt und an Auserwählte verschenkt wurden.
Als Krieger waren die Samurai in hierarchisch strukturierten Verbänden organisiert, die untereinander Bündnisse eingingen und auf diese Weise Truppen von vielen Tausend Mann bilden konnten.
Doch sie waren nicht nur Krieger. Viele konnten lesen und schreiben, so dass sie – vor allem in Friedenszeiten – in der Verwaltung von Ländereien oder ähnlichen Einheiten wirkten, wie auch in den Organen der öffentlichen Ordnung. Manche waren gebildet und widmeten sich gern den traditionellen Künsten. Einige schafften es zu wahrer Meisterschaft, etwa in der Kunst der Teezeremonie, Kalligraphie, Malerei und Dichtung.
Der Aufstieg der Samurai zur Kriegerelite
An der Spitze des japanischen Staates stand der göttlich verehrte Tenno, der „Himmlische Herrscher“ bzw. Kaiser. Dieser war jedoch nicht immer der mächtigste Mann im Staate. Über viele Jahrhunderte führten große Familienclans blutige Kriege um Macht und Vorherrschaft und schwächten damit die Stellung des Kaiserhauses. Bis Ende des 12. Jahrhunderts das erste Shogunat gegründet wurde. Der Minamoto-Clan hatte sich gegen alle anderen durchgesetzt und eine Militärherrschaft etabliert. Die Macht über Japan lag nun in den Händen eines Shogun (Militärgouverneur). Ihm untertan waren die Feudalherren mit ihren Lehen und die Samurai. Letztere bildeten das Rückgrat der Militärherrschaft. Der Tenno, Kaiser, galt nur noch symbolisch als oberste Instanz.
Diese Ordnung hielt sich – mit einigen Unterbrechungen – fast 700 Jahre. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnte die kaiserliche Herrschaft wiederhergestellt werden.

Blütezeit der Samurai
Mit der Herrschaft der Shogune begann die Blütezeit der Samurai. Als Mitglieder des Kriegeradels genossen sie hohes Ansehen und Privilegien, wie etwa das Tragen von Waffen. Das Katana, ein langes Schwert, wurde zu ihrem Symbol.
Wer sich einem Samurai widersetzte, riskierte sein Leben, denn das Waffenprivileg bedeutete, dass er bei mangelndem Respekt und Gehorsam strafen und sogar töten durfte.
Kakunodate, die Stadt der Samurai
Auf den Spuren der Samurai erreichten wir die Kleinstadt Kakunodate. Sie wurde nach einer Burg aus dem 16. Jahrhundert benannt, die heute nicht mehr existiert.
Rund achtzig Samurai-Familien lebten hier, und zwar ihrem Rang entsprechend in stattlichen Anwesen oder bescheidenen Häusern. Etwa ein Dutzend der Wohnstätten sind erhalten geblieben. Einige stehen versteckt hinter hohen Zäunen und im Schatten alter Bäume, darunter vieler Kirschbäume.

Manche sind bewohnt und für die Öffentlichkeit unzugänglich. Andere können besucht werden. Sie bieten mit kleinen Ausstellungen interessante Einblicke in das Leben der Krieger.


Handwerkskünste der Samurai
Samurai niederen Ranges besserten ihr bescheidenes Einkommen oft durch einen Nebenerwerb auf, indem sie sich beispielsweise als geschickte Kunsthandwerker betätigten. Kakunodate ist bekannt für Gebrauchsgegenstände und Zierrat aus polierter Kirschbaumrinde. Wie aufwendig deren Verarbeitung ist, wird im örtlichen Besucherzentrum demonstriert.

Beim Rundgang durch das Viertel begegnete ich der Geschichte des Odano Naotake (1749-1780), Sohn eines Samurai, der lieber zum Pinsel als zum Schwert griff und ein berühmter Maler wurde.


Odano Naotake gehörte zu den ersten japanischen Künstlern, die westliche Maltechniken erlernten, unter anderem das perspektivische Zeichnen.
Eine Gruppe von Ärzten hatte ein holländisches Anatomiebuch ins Japanische übertragen. Dabei handelte es sich um die Ausgabe der Anatomischen Tabellen des deutschen Arztes Johann Adam Kulmus (1689-1745). Im Rahmen dieses Projektes übernahm Odano Naotake die Illustrationen des menschlichen Körpers nach Vorlage des Originalwerkes.

Es war das erste westliche medizinische Buch, das ins Japanische übersetzt wurde. Es erschien 1774 in einer fünfbändigen Ausgabe, ein Bestseller im damaligen Japan.
Der legendäre Samurai Date Masamune (1567-1636)

Man nannte ihn „Einäugiger Drache“. Er hatte als Kind durch eine Pockenerkrankung sein rechtes Auge verloren, ein Makel, den er mit Stolz trug und der ihn nicht daran hinderte, ein mächtiger Samurai zu werden. Bereits mit vierzehn Jahren kämpfte er an der Seite seines Vaters gegen verfeindete Clans. Mit siebzehn übernahm er die Führung des Date-Clans und gewann damit den Rang eines Daimyo, eines Feudalfürsten. Seine kostbare schwarze Rüstung und sein prächtiger Helm mit goldener Mondsichel waren respekteinflößend und legendär.
Date war nicht nur ein mutiger Krieger und mächtiger Feudalherr, er war auch ein kluger Stratege und ungewöhnlicher Visionär. Er förderte Kunst und Kultur, Handel und Handwerk.
Unsere Reiseroute führte durch Dates ehemaliges Herrschaftsgebiet. Dort gründete er im Jahre 1600 die Burgstadt Sendai, die sich zu einem lebendigen Wirtschaftszentrum entwickelte und noch heute als größte Stadt im Nordosten Honshus von Bedeutung ist.
Date Masamune erkannte den Wert moderner ausländischer Technologie und knüpfte deshalb internationale Kontakte. Christliche Missionare durften in seinem Herrschaftsgebiet wirken. Er entsandte sogar eine Delegation nach Rom.
Bis heute hält die Stadt Sendai Date Masamune in hohen Ehren.
Das alte Städtchen Ouchi-Juku
Wir besuchten das Örtchen Ouchi-Juku, das heute vor allem für seine aus Buchweizen hergestellten braunen Soba-Nudeln bekannt ist. Verwundert fragte ich mich, welche Spuren der Samurai es hier gab.
Es war die Lage an einer alten Fernstraße, die den Ort historisch bedeutsam macht.

Hier rasteten die Feudalfürsten mit ihren Samurai auf ihrer Reise von und nach Edo, das heutige Tokyo, damals Residenzstadt der Shogune.
Seit dem 17. Jahrhundert herrschte der Tokugawa-Clan über Japan. Er verlangte von den Feudalfürsten, regelmäßig nach Edo zu kommen, um persönlich Rechenschaft über ihr Handeln abzulegen. Sie mussten mit ihrem gesamten Gefolge anreisen, einschließlich ihrer Samurai-Krieger. Gruppen von Dutzenden, Hunderten, wenn nicht gar Tausend Mann waren dann unterwegs, für deren Transport und Unterhalt die Fürsten riesige Summen aufzubringen hatten, zumal sie eine gewisse Zeit in Edo bleiben und deshalb für angemessene Unterkünfte sorgen mussten. Weitere Kosten verursachte die Aufrechterhaltung von Ordnung und Verwaltung ihres zurückgelassenen Lehens. Das betraf auch die landbesitzenden Samurai, die dadurch im Laufe der Zeit in finanzielle Schwierigkeiten gerieten.
Reisten die Regionalfürsten wieder ab, hatten ihre Angehörigen als Geiseln in Edo zu bleiben. So stellten die Tokugawa-Shogune sicher, dass die Feudalherren keine Rebellion wagten.
Der Niedergang der Samurai
Während der langen Friedenszeit des letzten Shogunats (1600-1868) verloren die Samurai an Bedeutung, denn ihre Kampfkunst wurde nicht mehr gebraucht. Über Jahrhunderte hatten sie als Mitglieder der Kriegerelite an der Spitze der sozialen Hierarchie gestanden, vor den Bauern, Handwerkern und Kaufleuten. Man zollte ihnen Respekt und bewunderte sie. Doch nun mussten sie nach einer neuen Beschäftigung suchen. Mit zahlreichen Hilfsprogrammen versuchte man sie in Verwaltung, staatlichen Institutionen und Ländereien unterzubringen. Mit mäßigem Erfolg. Viele Samurai konnten sich ihren alten Lebensstandard nicht mehr leisten und verarmten oder verschuldeten sich bei wohlhabenden Handwerkern und Kaufleuten.
Hinzu kam, dass immer mehr westliche Feuerwaffen ins Land gelangten. Selbst ein einfacher Bauer konnte mit einem Gewehr einen hochtrainierten Samurai leicht zur Strecke zu bringen.

Zunächst gelang es den einflussreichen Samurai, die allgemeine Verbreitung von Feuerwaffen zu verhindern. Dabei half der Beschluss der Shogun-Regierung, Japan vom Rest der Welt abzuschotten, um das Eindringen neuer Ideen zu verhindern, wie die des Christentums. Man befürchtete einen schlechten Einfluss auf die traditionellen Werte. Durch die Missionare hatte das Christentum seit Mitte des 16. Jahrhunderts Anhänger in allen Gesellschaftsschichten gefunden. Auch unter den Samurai, von denen sich einige nun weigerten, ihrem Herrn volle Loyalität zu zollen und ihm notfalls bis in den Tod zu folgen.
Fortan untersagte man Ausländern den Aufenthalt in Japan, mit Ausnahme von Händlern aus Holland und China. Erst 1853 gelang es amerikanischen Kanonenbooten, die Öffnung japanischer Häfen zu erzwingen. Gegen die moderne Waffentechnik der ausländischen Schiffe hatten die veralteten japanischen Kanonen nichts ausrichten können.
Rufe nach einem Abdanken der schwachen Shogun-Regierung und nach Wiederherstellung eines starken Kaiserhauses wurden immer lauter. 1868 war es so weit: Die Streitkräfte der Shogun-Regierung trafen auf die Armee des Kaisers. Die Kämpfe gingen als Boshin-Bürgerkrieg (1868-1869) in die Geschichte ein.
Die Kranichburg, Tsurugajo, von Aizu-Wakamatsu
Ihre weißen Mauern und roten Ziegeldächer erinnerten an einen Kranich, der seine Flügel ausbreitet, weshalb man sie „Kranichburg“ nannte.

Sie wurde im 14. Jahrhundert errichtet und in der folgenden Zeit ständig erweitert, bis sie als uneinnehmbar galt.
Der Fürst von Aizu, Herr über die Kranichburg, stand im Kampf gegen die kaiserlichen Truppen loyal auf Seiten der Shogun-Regierung. Und somit kämpften auch seine Samurai gegen die kaisertreue Koalition.
In Aizu-Wakamatsu bestiegen wir den Iimori-Berg, einen eher unscheinbaren Hügel von etwa 300 Metern Höhe. Doch ein Aussichtspunkt bot einen weiten Blick über die Stadt und nähere Umgebung. Direkt vor uns lag ein Abhang mit vielen Gräbern, hinter uns eine Gedenkstätte für neunzehn junge Samurai.
Eine merkwürdige Stille umgab uns. Niemand sprach. Meine Freunde schauten ergriffen in die Ferne, dorthin, wo sich einst die stolze Kranichburg befunden hat. Schließlich wandten sie sich um und T. sagte: „Genau an dieser Stelle haben sie gestanden. Hier ist es passiert!“ Und dann erzählte er mir die Geschichte von den neunzehn jungen Samurai.
Die Tragödie der „Weißen Tiger“
Als der Fürst von Aizu seine Truppen zum Kampf gegen die kaisertreue Armee aufrief, folgten ihm seine Samurai tapfer in den Krieg. Unter ihnen befand sich die etwa 340 Mann starke Byakkotai-Reservebrigade, „Weiße Tiger“ genannt, von denen kaum einer älter als sechzehn Jahre war. Sie waren unerfahren, die wenigsten hatten bisher an Kriegshandlungen teilgenommen. Im Schlachtengetümmel zeigte sich schnell, dass sie dem Feind hoffnungslos unterlegen waren. Einer nach dem anderen fiel, die übrigen flüchteten in Panik, zwanzig schafften es auf den Iimori-Berg. Doch von dort reichte ein kurzer Blick, um zu erkennen, wie aussichtslos ihre Lage war.

Sie sahen Feuer lodern und Rauch aufsteigen. Die Kranichburg schien zu brennen. Sie musste bereits in Feindeshand gefallen sein, was bedeutete, dass die Schlacht gegen die kaiserlichen Truppen verloren war.
Seppuku auf dem Iimori-Berg
Sie waren verzweifelt und gerieten in einen heftigen Streit. Was sollten sie tun? Zurück auf das Schlachtfeld und durch Feindeshand sterben? Sich ergeben? Die meisten von ihnen waren Söhne hochrangiger Samurai. Wie ihre Väter hatten sie ihrem Herrn, dem Fürsten von Aizu, Treue bis in den Tod geschworen. So konnte es angesichts der schmachvollen Niederlage nur einen Ausweg geben. Sie entschieden sich für Seppuku, den rituellen Freitod, zur Wahrung ihrer Ehre als Samurai, wie es der Weg des Kriegers, Bushido, verlangte. Und wirklich zog einer nach dem anderen seinen Dolch und schlitzte sich den Bauch auf.


Nur einer der jungen Samurai überlebte, weil er rechtzeitig von einem Bauern gerettet wurde: Sadakichi Iinuma. Er gehörte zu den jüngsten der „Weißen Tiger“, war erst vierzehn Jahre alt, als er mit den anderen in den Krieg zog. Durch Sadakichi Iinuma – er wurde 76 Jahre alt – blieb die Tragödie unvergessen und mit ihr auch der Irrtum, auf dem sie basierte. Denn nicht die Kranichburg stand in Flammen, sondern einige benachbarte Häuser.

Erst zwei Monate nach dem Tod der jungen Samurai erfolgten Belagerung und Beschuss der Kranichburg, was zur Kapitulation des Fürsten von Aizu führte.

Anbruch einer neuen Zeit
Seit 1867 saß ein junger Tenno auf dem Thron. Er hatte im Alter von vierzehn Jahren die Nachfolge seines verstorbenen Vaters angetreten.
Seine Regierungsdevise lautete: Meiji (aufgeklärte Herrschaft). Unter dieser Devise ist er heute noch bekannt. Der sogenannte Meiji-Kaiser wollte Japan in einen modernen Staat umwandeln, doch das setzte den Sturz des alten Regimes voraus.
Obwohl die Streitkräfte der Shogun-Regierung den kaisertreuen Truppen zahlenmäßig überlegen waren, wurden sie vernichtend geschlagen. Der letzte Shogun des Tokugawa-Clans dankte 1868 ab und Japan trat in ein neues Zeitalter. Ein neues politisches System nach westlichem Vorbild wurde aufgebaut, Japan in eine konstitutionelle Monarchie umgewandelt.

Ende und Wiederaufbau von Teilen der Kranichburg
Die berühmte Kranichburg ging nach der Kapitulation des Fürsten von Aizu an den Meiji-Kaiser. Dieser ließ die Burg 1874 abreißen.
In den 1960er Jahren besann man sich eines Besseren und baute zumindest den Hauptturm originalgetreu wieder auf. Er beherbergt ein sehenswertes Museum, das über die Geschichte der Burg und die Herrscher von Aizu detailliert berichtet.
Der letzte wahre Samurai
Zurück in Tokyo spazierten wir durch den riesigen Ueno-Park. Ich bemerkte eine hohe Bronzeskulptur, vor der sich mehrere ältere Herren fotografieren ließen. Es war Saigo Takamori (1828-1877), einer der berühmtesten Samurai in der japanischen Geschichte, dem man hier gedachte. Für viele Japaner ist er ein Nationalheld.

Als Sohn eines Samurai von niederem Rang durchlief er eine Militärausbildung, stieg innerhalb der Krieger-Hierarchie schnell auf und erlangte höchste Ämter und Ehren.
Für japanische Verhältnisse war er mit einer Körpergröße von 1,80 Meter und einem Gewicht von etwa 90 Kilo eine beeindruckende Erscheinung.
Im Kampf gegen das verhasste Shogunat kommandierte er 50.000 Samurai und ebnete damit den Weg für eine Rückkehr der kaiserlichen Herrschaft. Nach dem Sieg über das Shogunat ernannte ihn der Meiji-Kaiser zum General der neu gegründeten Nationalarmee. Der junge Kaiser schätzte Saigos Rat und übertrug ihm die Leitung der Kaiserlichen Garde von 10.000 Mann. Mit dieser Garde stärkte Saigo dem Kaiser den Rücken, als es galt, die Lehnsgebiete wieder in den Besitz der Krone zu bringen.
Saigo Takamori erhoffte sich von dem jungen Kaiser den Aufbau eines starken Japan, doch wie dieses aussehen sollte, darüber gingen ihre Vorstellungen weit auseinander. Saigo missfiel eine rasche Modernisierung des Landes. Er, der als Musterbeispiel eines wahren Samurai galt, erkannte seinen Verrat an den alten Traditionen. Denn die Meiji-Reformen, die er bisher so tatkräftig unterstützt hatte, liefen darauf hinaus, die Samurai als Kriegerelite abzuschaffen. Enttäuscht trat er von seinen Ämtern zurück und begab sich in seine Heimatstadt Kagoshima, wo er eine Privatschule für die Samurai-Ausbildung gründete. Tausende ehemalige Samurai folgten ihm, was die Regierung mit Argwohn beobachtete.
Aufstand der Ehre gegen den Fortschritt
1877 rebellierten Saigo und seine Samurai gegen die Reformen der Regierung und lieferten sich mehrere Gefechte gegen die kaiserliche Armee. Sie hatten jedoch keine Chance gegen die modern ausgerüsteten Soldaten des Kaisers. Die Samurai gingen im Kugelhagel unter.
Saigo Takamori wurde schwer verletzt und beging angeblich Seppuku, um einer Gefangennahme und Bestrafung als Rebell zu entgehen. Um seinen Tod ranken sich mehrere Legenden.
In der Bevölkerung blieb Saigos Ruhm als Kämpfer für die wahren Werte unangefochten. Die Regierung hielt es schließlich für geraten, ihn trotz seiner Abkehr von den kaiserlichen Reformen posthum zu begnadigen.
Die Skulptur im Ueno-Park von Tokyo stellt ihn in Jagdkleidung und mit seinem Lieblingshund dar.
Saigos Schicksal inspirierte zu dem Film „The Last Samurai“ mit Tom Cruise. Der Zufall wollte es, dass ich den Film während meines Rückfluges im Bordprogramm der Fluggesellschaft sehen konnte.
Entstehung eines Mythos – Samurai-Museum Berlin
Die Helden des alten Japan, die Samurai, lebten in einer Welt aus Regeln, Ritualen und Loyalität und zahlten dafür oft einen hohen Preis. Dennoch lebt ihr Geist bis heute in vielen Aspekten der modernen japanischen Gesellschaft fort.
Ihr Mythos fasziniert inzwischen auch die Menschen in Deutschland. Mag sein, dass es die Tugenden des Bushido sind, die in den heutigen unruhigen Zeiten das Interesse an den Samurai wecken. Werte wie Aufrichtigkeit – nämlich ehrlich in Worten und Taten zu sein. Ein Samurai lügt nicht. Höflichkeit – respektvolles Verhalten auch Feinden gegenüber. Mut – der auf Vernunft und nicht auf Leichtsinn basiert. Ob sich die Samurai immer daran gehalten haben, sei dahingestellt.
Bemerkenswert ist das Berliner Samurai-Museum (Auguststr. 68, Berlin Mitte), das Erwachsene, Jugendliche und Kinder gleichermaßen anzieht.

Es verfügt zum Thema Geschichte und Kultur der Samurai über eine der größten Privatsammlungen außerhalb Japans.
Ein Besuch lohnt sich.
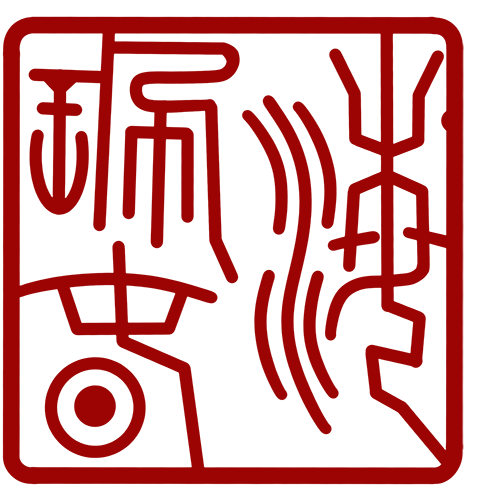












1 Kommentar
Sehr gut gemacht! Chapeau für Deine Recherche. Als “alter” (im wahren Wortsinne) Aikidoka hat mich das natürlich sehr interessiert. Den Film über den japanischen Gesandten nach Rom zum Papst habe ich vor einigen Jahren gesehen. Er heißt “A Samurai at the Vatican”; er wurde auf ARTE auch auf Deutsch ausgestrahlt. Ein absolut faszinierender Film. Weiß aber nicht, wie man noch an ihn rankommt. Vielleicht hierüber: https://www.gedeonmediagroup.com/en/production/a-samurai-at-the-vatican/